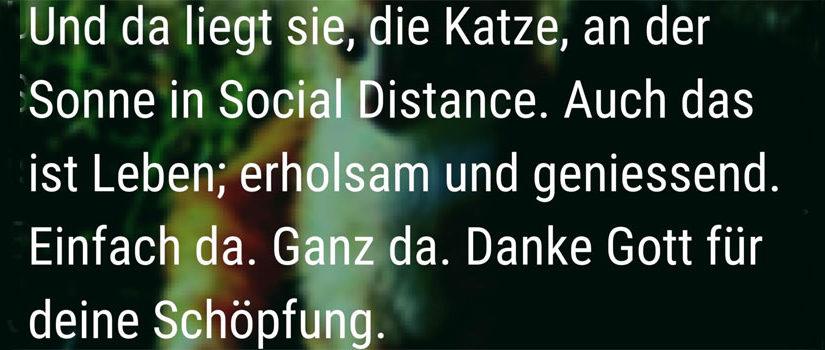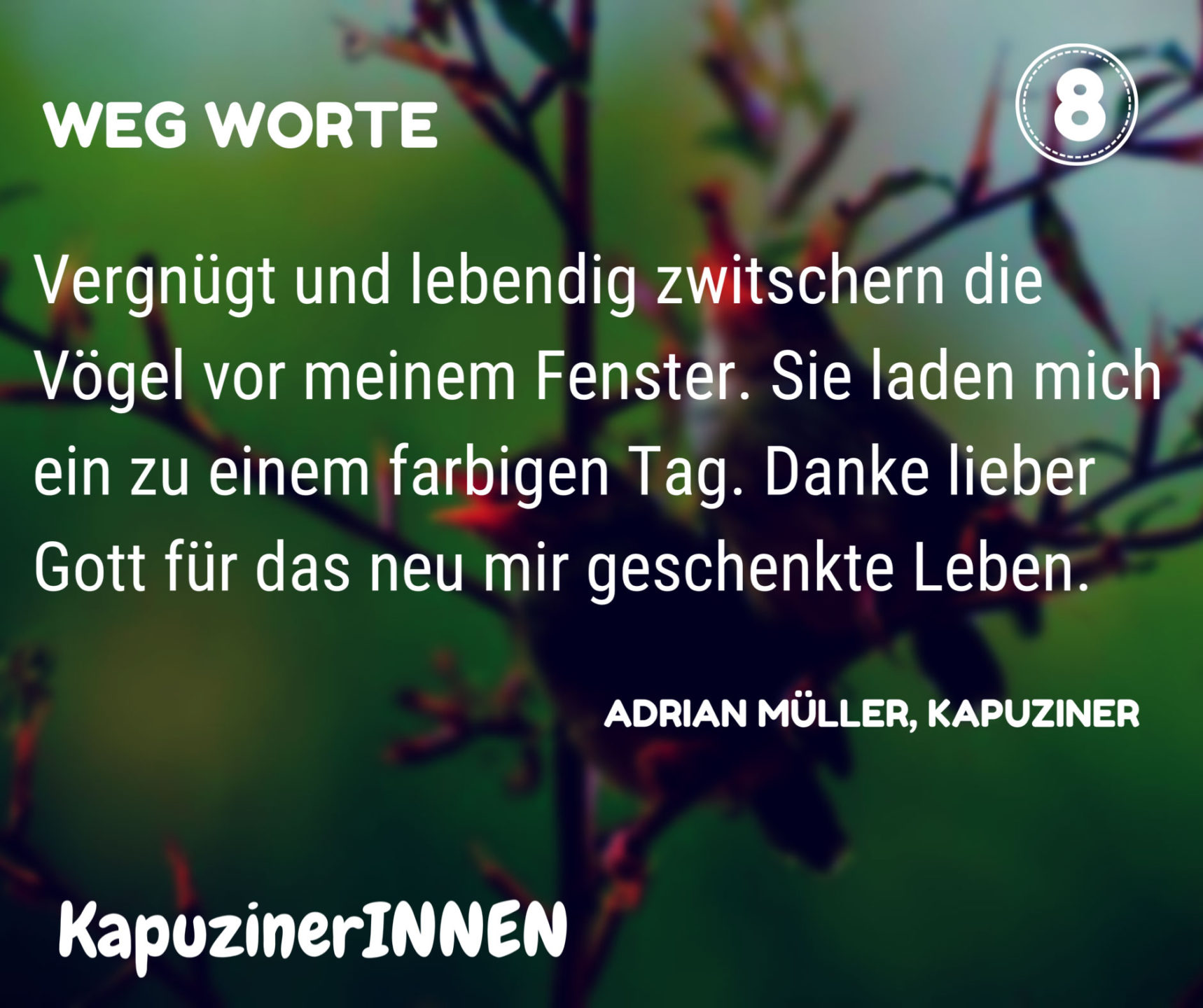Liebe Leserinnen und Leser
Vor 100 Jahren sind die ersten Kapuzinerbrüder und Baldeggerschwestern nach Tansania aufgebrochen. Zuerst ging es ihnen um die christliche Glaubensverkündigung und später immer mehr um Lebensgrundlagen: Bildung und Gesundheit. An vielen dieser ursprünglichen Missionsstationen stehen heute Kirchen, Schulen und kleine Spitäler (Dispensaries) nahe beieinander. Oft sucht man vergebens nach Schweizern oder Schweizerinnen vor Ort. Tansanische Brüder, Schwestern, Lehrer und Pflegefachleute führen weiter, was die Missionare und Missionarinnen begonnen haben und bringen Früchte in Tansania.
Weitsichtige Brüder, Schwestern und Laien haben bald einmal gemerkt, dass die Missionen nicht nur Auswirkungen auf Tansania haben, sondern auch auf die Schweiz. Man sammelte nicht mehr nur Geld für die Missionen, sondern erzählte in der Schweiz von den Tansaniern. Die Kapuziner haben diesen entwicklungspolitischen Dialog bei uns vor allem mit der Zeitschrift «ite» vorangetrieben und mit dem Missionskalender den Spender und Spenderinnen gedankt.
Heute spricht man von Entwicklungs-Zusammenarbeit und von Partnerschaft. Es geht um einen kreativen Austausch der Kulturen. Doch soll und darf dabei der geistige und seelsorgerliche Austausch nicht vergessen werden. Es geht nicht nur um Wirtschaft. Wie die ersten Kapuziner, so hat auch dieser Missionskalender die Bibel ins Zentrum gestellt. Sie verbindet heute viele Menschen in Tansania und der Schweizmiteinander.
Die Redaktion hat für 2021 als Leitsatz für den Missionskalender einen Vers aus dem Johannes-Evangelium gewählt: «Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt» (Joh 15,16). Ja, viele Früchte sind heute in Tansania und in der Schweiz zu sehen. Dafür wollen wir Brüder allen Beteiligten herzlich Danke sagen. Nicht alle, aber viele Früchte sind geblieben und heute noch zu geniessen.
Nicht zu vergessen sind die Früchte, die uns die Missionare und später auch die Tansanier selber aus dem Süden in die Schweiz gebracht haben. Als junger Mann, vor meiner ersten Afrikareise nach Ruanda, war ich fasziniert von der «Bantu-Philosophie»; später, in der Theologie, dachte ich über den «Schwarzen Christus» nach. Oder heute in der Fachkommission von «Film für eine Welt» begeistert mich das vielfältige, kritische und kreative Filmschaffen aus dem Süden. Eine echte Bereicherung. Danke! Meine besten Glückwünsche zu diesem hundertjährigen Kulturaustausch und den guten Früchten, die geblieben sind. Weitere, bleibende Früchte wünsche ich mir.
Pace e bene
Adrian Müller