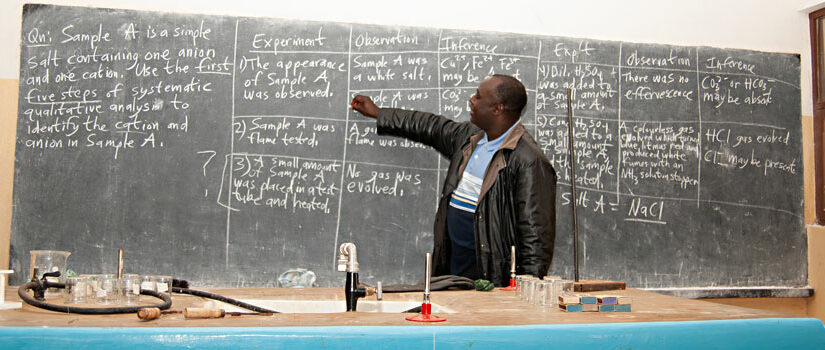Grundsatzartikel in ITE 2022/5
Franziskanisches Handeln kennt drei Dimensionen: Einerseits gut hinschauen und dann mit Elan handeln. Nötig dafür sind spirituelle Grundlagen, die dem Handeln Orientierung geben. Dieser Artikel vermittelt auf erzählerische Weise franziskanische Grundlagen fürs konkrete Handeln, das in den nachfolgenden Artikeln im Zentrum steht.
Kalt ist es draussen, es liegt matschiger Schnee auf dem Boden. Ein hellgelb erleuchteter Weg führt gerade zum nahen Hotel – und ein steiler dunkler Weg, mit Kerzen ausgeleuchtet, hinunter in den Ranft. Eine Gruppe Menschen macht sich auf den Weg in die tiefe Schlucht. In der Kapelle unten bei Bruder Klaus wollen sie für den Frieden beten. Jeder Schritt muss bedächtig gesetzt werden, es ist rutschig. Dieser Weg ist gelebte Friedensmeditation: Zu rasch entgleitet manchmal der Fuss, der Friede und wir Menschen haben das Nachsehen.
Auf dem dunklen Weg in die Schlucht hinunter halten die Menschen immer wieder an und gedenken schwieriger Situationen, Menschen, denen das weihnächtliche Licht zu wünschen ist. Unten angekommen, wendet man sich mit der Bitte um Frieden an Gott und feiert Gottes Friedensvisionen, wie sie beispielsweise im Psalm 85 aufleuchten: Es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Vielleicht trägt man konkrete Erfahrungen mit sich? Oft bleiben diese Visionen jedoch ein Wunsch für die Zukunft – und da gibt es noch Einiges zu tun! Auch für Gott. Darum: Komm Heiliger Geist …
Eine Friedensgeschichte
Diese Geschichte möchte ich frei nacherzählen:
Franz von Assisi keucht den Bergweg hoch. Durch die wunderbaren Kastanienwälder erreicht er das kleine Klösterlein Montecasale. Ruhig und beschaulich ist die Landschaft. Ideal für das Leben in Abgeschiedenheit und Gebet. Doch wehe dem Ankömmling. An dem abgelegenen Ort erwarten Brüder Franziskus in grosser Aufregung! «Franz, das kannst du dir nicht vorstellen», zischt ein erster Bruder, «da waren wir am Montag in der nahen Stadt arbeiten und trugen Brot und Früchte in unsere Einsiedelei hinauf. Am Mittwoch, während des Morgengebets, haben uns Räuber die ganze Vorratskammer geplündert und wir starteten den Tag mit Hunger.» «Lieber Franziskus», bittet ein anderer, «ich will weg von hier. In der Stadt unten sagen sich die Bürger, wir seien völlig verfressen. Seit Wochen bestehlen uns die Räuber. Wir müssen stets von neuem zu den Menschen gehen und um Nachschub fragen. Das ist peinlich, das halte ich nicht aus!» Kaum hat der zweite geendet, findet der dritte Bruder: «Weg müssen sie, diese Diebe. Einfach weg. Ich bin hierhergekommen, meinen Frieden zu finden und in Stille bei Gott zu sein. Aber das ist Schnee von gestern.»
Franziskus hatte sich seinen Aufenthalt in der Einsiedelei etwas beschaulicher vorgestellt. Doch wird von ihm eine Antwort erwartet und er will diese auch geben. Seine Mitbrüder, aber auch die Brüder Räuber, tun ihm leid. Nach stillem Beten und Nachdenken ruft Franz seine Mitbrüder zu sich und rät ihnen zu folgendem Vorgehen: «Liebe Brüder, wenn ihr das nächste Mal von der Stadt in die Einsiedelei kommt, dann nehmt die Hälfte der Esswaren für euch. Mit der anderen Hälfte geht ihr in den Wald, breitet in der Lichtung oben die Gaben auf dem Boden sorgfältig aus, zieht euch zurück und ruft den Räubern: Liebe Leute, ein Geschenk für euch›. Ab dem dritten Mal bleibt ihr in der Nähe der Lichtung stehen, ab dem fünften Mal bedient ihr selber die Räuber. Und dann sehen wir weiter. Gebt mir Bescheid.»
Die Brüder schlucken schwer, als Franziskus aufbricht. Aber man kann ja einen Heiligen nicht um Hilfe fragen und dann nicht nach seinen Ratschlägen handeln. Und so tun die Brüder in den kommenden Wochen, wie Franz es ihnen geraten hat. Beim ersten Versuch zittern die Brüder wie Espenlaub, oder waren es vielleicht die Räuber, die innerlich verängstigt zittern? Je öfter man die Räuber trifft, desto mutiger und kecker wird das Auftreten der Brüder. Mit der Zeit kennt man sich und beginnt zu scherzen. Die Brüder realisierten: Die Räuber waren aus der Stadt vertrieben worden, geächtet und fanden im Wald wenig Essen und keine Arbeit. Sie lebten als Vertriebene und hinter jedem von ihnen verbarg sich eine leidvolle Lebensgeschichte.
Die Legende endet damit, dass einige Räuber menschenfreundliche Franziskaner wurden, die anderen anständige Bürger der Stadt. Stadt und Umgebung erlebten wirtschaftlichen Aufschwung und niemand musste mehr Angst haben, in den Wald zu gehen. Selbst kleine Kinder konnten im Wald Pilze sammeln gehen und riefen sie nach den Räubern, kamen Brüder.
Bilder und Deutungen
Brasilianische Mitbrüder deuten diese Franziskuslegende wie folgt: Menschen, die das Nötige fürs Leben haben, müssen nicht gefürchtet werden. Vor allem gerecht integriert müssen sie sein. Wie Jesus oder Franziskus sollen die Christinnen und Christen sich besonders für Aussenseiter einsetzen und so dürfen sie manchmal die Erfahrung von Montecasale machen, dass Räuber gar nicht zu fürchten sind. Im Gegenteil. Gottes Geist wirkt auch in ihnen Grosses.
Ein anderes Bild des Franz von Assisi, das auch Papst Franziskus aufgegriffen hat, ist jenes der Geschwisterlichkeit: Christen und Christinnen, ja alle Menschen, haben einen gemeinsamen Vater, eine gemeinsame Mutter im Himmel. Das macht Menschen unter sich, aber auch mit Tieren und Pflanzen zu Brüdern und Schwestern, zu Geschwistern. Und das verbindet familiär. Stimmt, auch Geschwister gehen nicht immer friedlich miteinander um. Aber die Vorstellung der Geschwisterlichkeit stellt uns auf die gleiche Stufe. Gut, auf Erden fehlt uns manchmal der Vater oder die Mutter, die die Gaben der Gerechtigkeit und des Versöhnens haben. Dann sollen die älteren und vor allem die weiseren Geschwister für Gerechtigkeit und Frieden sorgen.
Ausblick
Heute ist Gerechtigkeits- und Friedensarbeit komplex und anspruchsvoll. Diese ITE-Ausgabe erzählt von unterschiedlichen franziskanisch Engagierten. Der Schweizer Kapuziner Adrian Holderegger arbeitet bei der UNO als «Ambassador for Peace». «Franciscans International» engagiert sich seit mehr als dreissig Jahren als NGO bei den Vereinten Nationen. Unser Westschweizer Mitbruder und Missiologe Bernard Maillard erzählt von seinen Erfahrungen mit ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture) in ausländischen Gefängnissen. Ach ja, kennen sie die «Roten Kapuziner» der Westschweiz? Beat Baumgartner weiss mehr …