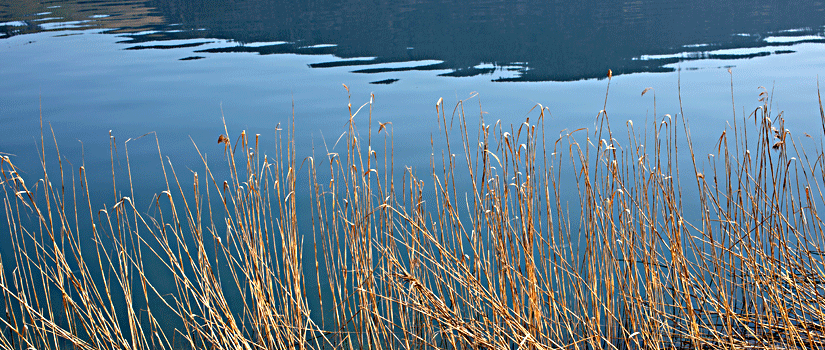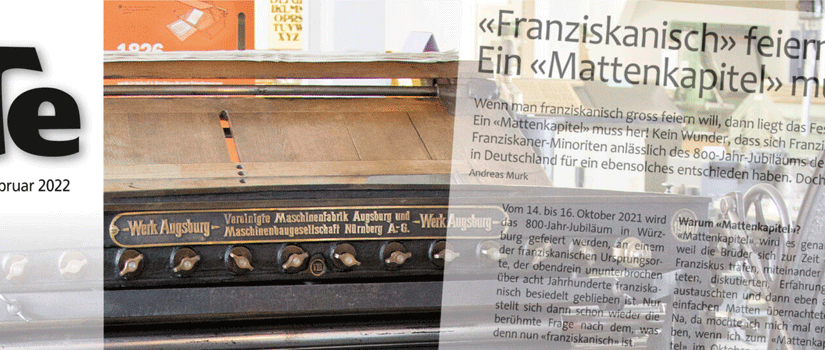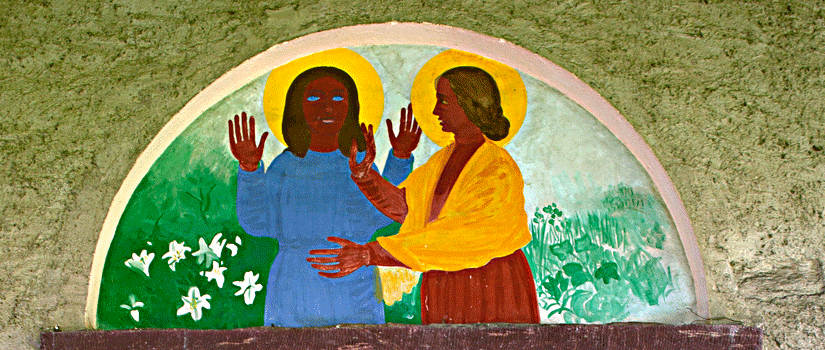Telebibel: Nein, einen Erst-April-Scherz gibt es hier nicht. Bis Mitte April möchte ich einige Texte aus dem sogenannten Dritten Jesaia, das sind die Kapitel 56 bis 66 des Jesaia-Buches meditieren. Ende 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass diese Kapitel nach dem babylonischen Exil Israels, nach 539 vor Christus, verfasst worden sind. Heute ist man vorsichtiger und sieht unterschiedliche Autoren, oder besser Propheten am Werk. Doch haben wir nun mit Corona und mit Ukraine-Krieg auch eine Zeit danach – so ist jedenfalls zu hoffen. Hier können die Beiträge gehört werden. Viel Vergnügen.
Kategorie: Allgemein
Töchter und Söhne Gottes
Predigt zu Phil 3,17-4,1 und Lk 9,28b-36
Der Soziologe Armin Nassehi beschreibt in seinem Buch «Unbehagen» eine überforderte Gesellschaft. Seine Studierenden stellen sich die Frage, warum wir, obwohl wir so viele Möglichkeiten und Wissen hätten, unsere Probleme der Welt und des Lebens nicht lösten. Wir kennen viele Zusammenhänge über die Klima-Erwärmung und trotzdem erreichen wir wenig. Als Soziologen lernen seine Studierenden vieles über gesellschaftliche Zusammenhänge, und sehen die Gesellschaften stolpern immer wieder. Im jetzigen Moment steht uns die Ukraine sehr nahe. Wir möchten in Frieden leben, und wir erleben Krieg und erhöhen die Verteidigungsausgaben, kürzen im Gegenzug Sozialausgaben. Papst Franziskus sagt meines Erachtens zu Recht, dass es in einem Krieg immer nur Verlierer und keine Gewinner gäbe. Hört endlich auf!
Sigmund Freud hat 1930 eine Schrift herausgegeben mit dem Titel «Das Unbehagen in der Kultur». Etwas salopp kann man seine These folgender-massen zusammenfassen. Der Mensch braucht Feinde, um seinen Aggressionstrieb zu leben. Je grösser die Gruppe wird, desto schwieriger ist es, den Aggressionstrieb direkt auszuleben – denn die Feinde verschwinden in der Ferne. Sozialer Zusammenhalt muss nach Freud mit Abgrenzung von anderen erkauft werden. Keine Liebe ohne Hass also. Steter Kampf.
Brauchen wir Christen und Christinnen auch Abgrenzung? Wohl bis zum zweiten Vatikanischen Konzil kannten wir Katholiken auch eine echte Abgrenzung zur Gesellschaft. «Ausserhalb der Kirche kein Heil», war ein Schlagwort der Abgrenzung. Die Juden waren oft die Anti-Christen, später oft die Muslime. Katholiken und Katholikinnen lebten in der Schweiz in einem katholischen Milieu, das sich klar vom reformierten und liberalen Milieu isolierte: Katholische Vereine, katholische Laden, katholische Schulen, usw.
Auch der als Lesung gehörte Philipperbrief grenzt klar ein und klar aus. Da gibt es die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende sei Verderben, ihr Gott der Bauch und ihre Ehre bestände in der Schande; Irdisches haben sie im Sinn. Die Anhänger und Anhängerinnen des Paulus aber, hätten ihre Heimat im Himmel und ihr armseliger Leib würde eines Tages in einen verherrlichten Leib gewandelt. Haben Paulus und Sigmund Freud recht? Ohne Feinde kein menschliches Leben auf Erden? Liebe nur für die Eigenen?
Ganz real sind die Konflikte, die wir tagtäglich erleben. Teilweise, wie beispiels-weise Kriege, sind sie eindeutig menschgemacht. Klimawandel hat gewiss mit unserem Handeln zu tun. Im Moment würde ich mal vermuten, dass Corona nicht vom Menschen gemacht ist – Gewissheit habe ich da nicht. Doch gibt es Naturkatastrophen, die meines Erachtens wenig bis nichts mit uns Menschen zu tun haben. Die Natur kann brutal sein.
Im heutigen Tagesevangelium hören wir, wie Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus beten geht. Interessanterweise schlafen die drei Freunde während Jesus mit Mose und Elija redet. Es hätte mich ja interessiert, was Mose und Elija über das Ende Jesu in Jerusalem Jesus gesagt haben. Später, am Ölberg wird es wieder so sein, die drei Jünger schlafen, während Jesus mit Gott um sein Leben ringt: «Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich will, sondern was du willst!» (Mk 14,36) Gott will den Kelch?!
Selbst am Ölberg hat Jesus um sein Leben gerungen. In solchen Situationen schlafen Jesu die engsten Freunde selig. Im heutigen Tagesevangelium finde ich es bezeichnend, dass Petrus – sobald er wieder wach ist und das für Jesus wohl ernüchternde Gespräch abgeschlossen ist – Hütten bauen will. Ja, wir möchten doch alle, auch als Kirche, Sicherheiten und Gewissheiten. Am liebsten ein fröhliches Fest, Gesang und Tanz, Freude und Lobpreis. Doch trotz einem liebenden, barmherzigen und allmächtigen Gott ist die Welt auch anders.
Liebe Töchter und Söhne Gottes, trotz Sigmund Freund und trotz Paulus glaube ich nicht, dass wir zum Leben Feinde brauchen und nur auserwählte Menschen gewandelt werden. Ich glaube ans Ja Gottes zu allen Menschen, alle sind wir seine Töchter und Söhne. Drei Punkte sind mir wichtig:
- Die Natur ist Natur und als Menschen müssen und können wir lernen mit ihr zu leben, uns anzupassen, dass sowohl die Natur als auch wir Menschen Zukunft haben. Dabei wird die Natur unser Leben überleben, wenn wir es als Menschheit nicht schaffen. Nicht nur die Dinosaurier sind auf der Strecke geblieben. Sie können uns zu denken geben.
- Ob wir Menschen hier auf Erden zum friedlichen Zusammenleben finden, das weiss ich nicht, das hoffe ich jedoch sehr und ich beginne jeden Tag neu damit, am Frieden zu bauen. Das Unbehagen an einer überforderten Gesellschaft teile ich; ja, im Angesicht vom Krieg in der Ukraine, von der aktuellen Hungersnot am Horn von Afrika, in Madagaskar, von wo einer meiner Schwager stammt, auch die Überschwemmungen in Australien usw. belasten mich sehr.
- Wie können wir Christen und Christinnen an einen guten, barmherzigen, liebenden und allmächtigen Gott glauben, wenn wir die Härte der Natur und die Überforderung der Menschen sehen? Zu dieser Frage gibt es viele Bücher, ja Bibliotheken; doch meines Erachtens keine wirklich überzeugenden Antworten. Jesus zeigt uns im Evangelium, dass er zu Gottes Willen ja sagt, auch wenn es um eine für ihn düstere Zukunft geht. Als Verlierer und vom Tod Bedrohter weiss und hört er: «Dieser ist mein auserwählter Sohn». Zu uns wird gesagt: «auf ihn sollt ihr hören». Jesu Begegnung mit Mose und Elija sowie Gottes Ja lässt ihn und uns hoffen. Und auch wir dürfen uns sagen lassen, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind. Amen.
100 Jahre ITE
ite 1/22: Vor einem Jahrhundert publizierten die Kapuziner ihren ersten Missionsboten. Dieser wurde später in ITE umgetauft. «Tu Gutes und sprich davon.» war der Grundsatz. Dabei lernten die Brüder immer mehr, dass es auch kritische und vielfältige Blicke auf die Welt, die Kirche und das eigene Tun braucht. Im Verzeichnis der Schweizer Kapuziner finden sich 2022 fünf «Publikationen der Provinz»: Helvetia Franciscana, ITE, frère en marche, Franziskuskalender und Missionskalender. Mag sein, dass es auf der Kanzel etwas ruhiger geworden ist, doch sind die Brüder medial vielfältig präsent. ITE 2022.1 hält Rückschau und macht eine Bestandesaufnahme der Gegenwart. Die Brüder und die Redaktion sind motiviert in die Zukunft zu schreiben und fotografieren. Viel Vergnügen!
Gratis-Probenummern bei: Missionsprokura Schweizer Kapuziner, Postfach 1017, 4601 Olten. Telefon: 062 212 77 70. Oder www.ite-dasmagazin.ch

Wirklich frohe Botschaft?
Liebe Geschwister in Christus (Pedigt vom 13.02.2022)
Unser Wissen um die Zeit und Entwicklungsprozesse wächst und erweitert sich. Wir sind auf dem Weg und vieles ist offen. Letzthin war ich bei einem Patenkind zu Besuch. Er hat im Chemie-Unterricht nicht mehr nur ein Buch, wie ich damals, sondern auch Computer-Programme fürs Lernen. Und diese können Theorien veranschaulichen. Zum Beispiel: Wasser ist eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und Wasserstoff, H2O. Zu meiner Schulzeit hiess es, das Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Ich stellte mir vor, man wirft die Atome zueinander und sofort hat man Wasser. Bei der Animation auf dem Computer lernte ich, dass chemische Prozesse Zeit brauchen. Die verschiedenen Atome müssen sich finden und dann auch binden. Auf dem Bildschirm sahen wir die Atome in einem Aquarium herumschwirren und ab und zu, zack, da gab es eine Verbindung. Ich staunte und bin dankbar für dieses neue Verständnis von chemischen Prozessen. Auch da braucht es Zeit.
Oft ist es uns klar, dass Reifung Zeit braucht. Keine Frage, beim Wein muss man einige Jahre warten, bis er seinen Jahrgang hat. Bei einigen Prozessen kann man kaum warten, bis es soweit ist. Vor allem Kinder müssen sich bei einigem gedulden. Wenn ich die Schule fertig habe, dann … Wenn ich achtzehn bin, dann … Wenn ich einen Meter fünfzig gross bin, dann … darf ich in Rust auf den Eurospider. In meinem Alter höre ich wohl am ehesten, wenn ich mal pensioniert bin, dann bin ich frei und mache was ich will. Welche «wenn …, dann …» hören Sie am meisten in ihrem Alltag?
Bei Jesus ist die Satzstruktur: «Selig …, denn …»; aber auch «Weh euch …, denn …».
Bei der ersten Seligpreisung im Lukasevangelium gibt es keine Wartezeit: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Nun, diese Aussage ist eher ein Frust für mich, wohl für uns alle. Leben wir doch in einem reichen Land und wenige von uns können von sich behaupten arm zu sein. Selbst als Kapuziner mit dem Gelübde «ohne Eigentum» zu leben, hüte ich mich, von Armut zu sprechen. Und das Lukas-Evangelium vermeidet wohlweislich, Armut allzu schnell zu spiritualisieren. Ich denke, dieser Stachel in unserem Fleisch – wie es Paulus wohl formulieren würde – ist sehr wichtig und verhindert, dass wir uns zu schnell aus der Verantwortung für die Verteilung des Reichtums in der Welt nehmen und uns selbstgefällig zurücklehnen. Auch bei uns sind die sozialen Unterschiede gross.
Weiter hören wir aus dem Tagesevangelium:
Selig,
die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden.
Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern.
Selig,
die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.
Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und weinen.
Ehrlich, solche Sätze mag ich nicht. Nein, bitte nicht alles auf den Kopf stellen. Ziel soll es doch sein, dass niemand hungert, dass niemand weint, dass alle glücklich sind und in Fülle leben dürfen. Was sage ich als satter, übergewichtiger Mensch zu solchen Sätzen?
Eben habe ich in der Zeitung (www.journal21.ch) gelesen: «Zehn Prozent der Weltbevölkerung haben nicht genügend Nahrungsmittel. Das sind 811 Millionen Menschen. Allein im letzten Jahr stieg die Zahl um 161 Millionen. Dies berichtet die «UN Global Humanitarian Overview».» Mag sein, dass ich mit den vielfältigen Ursachen oft wenig zu tun habe. In der Zeitung ist zu lesen: «Eine wichtige Rolle spielen bewaffnete Konflikte, extreme Wetterbedingungen, Pflanzenkrankheiten, die Corona-Pandemie, logistische Schwierigkeiten, bedürftige Menschen zu erreichen – und Heuschreckenplagen.»
Und trotzdem dröhnt in meinen Ohren: Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Nun, eine echte Antwort auf diesen Weh-Ruf habe ich keine. Höchstens viel Gottvertrauen in Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Auch wir sind seine Geschöpfe und versuchen Verantwortung wahrzunehmen – auch wenn wir manchmal auf der Stecke bleiben.
Ach ja, und wie gehen wir mit dem letzten Gegensatzpaar um:
Selig
seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausstossen und
schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen.
Weh, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den
falschen Propheten gemacht.
Für mich haben diese Sätze gegenwärtig eine besondere Brisanz. Da denke ich beispielsweise an die Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche. Auf den klerikalen und hierarchischen Machtmissbrauch bin ich gar nicht stolz. Da braucht es einige und schnelle Veränderungen im System, aber auch im konkreten Leben.
Was können diese «Selig-» und diese «Weh-Sätze» von Jesus mir heute sagen?
Schwierig. Vielleicht; spring über deine eigenen Schatten, deine Bequemlichkeit, mache dich stark für das Leben und sei kritisch. Ändere deine Lebensgewohnheiten. Werde politisch. Orientiere dich nicht an Meinungen oder an Mehrheiten, sondern steh ein für den Gott des Lebens, der Gerechtigkeit will und Frieden schafft; den Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Überspringe konfessionelle, religiöse, wirtschaftliche, politische Widerstände und vertraue mit Jesus von Nazareth auf das Leben, auch wenn es zu verlieren scheint. Lebe, gewaltfrei und lebensbejahend ….
Paulus, wie
wir ihn in der Lesung gehört haben, macht mir Mut. Er schreibt: Nun aber i s
t Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen.
Ja, ich glaube, dass Gott die Schöpfung in seinen Händen hat und das Reich
Gottes eines Tages für alle Menschen vollendet wird, auch für uns. Ich glaube
und vertraue auf Gott, auch wenn ich noch nicht alle Zusammenhänge und
Verbindungen des Lebens und unseres Glaubens verstehe. Vielleicht ist das ein Prozess,
wie ich ihn mit meinem Patenkind zusammen auf dem Computer bestaunen konnte, ihn
aber jetzt noch nicht verstehen kann. Und da sage ich mir: Trau Gott und seinem
Ja zum Leben. Amen.
Bibeltexte 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6.17.20-26
Blick in die Feuilletons
SRF2: Adrian Müller ist der neue Präsident des Vereins Katholisches Medienzentrum. Als Provinzrat der Schweizer Kapuzinerprovinz engagiert er sich für die Brüder und Klöster der deutschsprachigen und französischsprachigen Schweiz. Er ist ausserdem Chefredaktor der Kapuziner Zeitschrift «ite». Wir sprechen mit ihm über seinen theologisch-journalistischen Blick auf die Medien. Hier geht es zum Beitrag.
Gott sagt ja; der Geist wirkt
Predigt vom 9. Januar 2022 zu Lk 3,15.21-22, Taufe des Herrn
Liebe Getaufte
Johannes der Täufer weiss gut, wer er ist und wer er nicht ist. Er taufe nicht mit dem Heiligen Geist, sagt er seinen Täuflingen. Jesus von Nazareth bekommt im heutigen Tagesevangelium von seinem Vater zugesagt: «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.»
Liebe Getaufte, wer sind Sie? Was ist Ihnen zugesagt worden?
Heute, am 9. Januar habe ich Namenstag. Nomen est omen, heisst es. Der Name ist Programm und wurde uns allen von unseren Eltern mit auf den Weg gegeben. Was haben sich unsere Eltern dabei gedacht? Eine meiner Schwestern hatte drei Kriterien für die Namensgebung ihrer Kinder:
- Kurz muss er sein, so dass man ihn im Berndeutsch nicht verkürzt.
- Da ihr Mann französisch spricht, muss er deutsch und französisch verwendet werden können.
- Der Name soll ästhetisch gut tönen. Luc und Joel heissen ihre Söhne.
Heute möchte ich Ihnen erzählen, wie ich die Botschaft meines Namens fand. Jesus von Nazareth hat den Zuspruch «mein geliebter Sohn» erst als Erwachsener erfahren. So erging es auch mir. Als ich bei den Kapuzinern das Postulat begann, fragte mich der Guardian als Erstes: Wann feierst du Namenstag? In Bern kennen wir den Brauch der Namenstage nicht. Ich suchte in der Klosterbibliothek Bücher zum Thema Namen und Namenstag und fand folgende drei Möglichkeiten für meinen Vornamen:
- Als ersten Adrian fand ich Hadrian von Nikomedia, der am 8. September gefeiert wird. Hadrian musste nach der Legende als Hauptmann der römischen Armee unter Kaiser Galerius Christen verfolgen. Deren Standhaftigkeit bekehrte ihn und führte ihn zum eigenen Martyrium. Nein, einen Soldaten und Märtyrer wollte ich nicht als Namenspatron. Das kann nicht mein Lebensziel sein. So suchte ich weiter.
- Für den 9. März fand ich einen weiteren Adrian. Leider auch Soldat und Märtyrer. Darum forschte ich weiter und wurde
- Mit dem heiligen Adrian von Canterbury fündig. Dieser wurde in Afrika geboren und starb am 9. Januar 710 in Canterbury. Sympathisch war und ist mir Adrian von Canterbury, weil er sich sehr für Bildung, Wissen, die Vernetzung von Kulturen sowie Verständigung und Frieden einsetzte. Dazu übernahm er auch Verwaltungs- und Planungsaufgaben. Das macht ihn mir sympathisch und das gab mir ein Lebensprogramm, mit dem ich mich 1989 anfreunden konnte und ich heute noch hochhalte. Dafür kann und will ich leben.
Wie ist das Namensprogramm von Jesus? Der Name Jesus ist die Kurzkurzform von Jehoschua. Der Name Jehoschua wurde nach dem babylonischen Exil meist in der Kurzform Jeschua verwendet. Jeschua war ein verbreiteter Vorname und kommt in der hebräischen Bibel vor allem als «Jehoschua ben Nun» vor. Jehoschua ben Nun hat das Volk Israel in das gelobte Land Kanaan geführt. Das biblische Buch Josua ist nach ihm benannt. Das Programm von Jehoschua ben Nun lässt sich auch auf Jesus von Nazareth übertragen: Jesus führt sein Volk zwar nicht ins gelobte Land Kanaan, aber die ganze Schöpfung durch Heilung und Versöhnung ins Reich Gottes. Das war sein Lebensprogramm: durch Heilung und Versöhnung ins Reich Gottes.
Unser heutiges Tagesevangelium enthält mehr als menschliche Zusagen und Absichten. Es ist Gott, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube, der auf Jesus herabkommt, und eine Stimme aus dem Himmel, die sagt: «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.» Es sind dies nicht menschliche Versprechen und Wünsche, sondern Gottes Zusage, die sich bei der Taufe durch Johannes ereignet. Diese Sohnes-Zusage gibt Jesus uns weiter, indem er uns lehrt, zum «Vater im Himmel» zu beten. So werden wir alle zu Töchtern und Söhnen des einen Gottes, aber auch zu Geschwistern vor ihm und mit ihm, Jesus von Nazareth.
Durch unsere eigene Taufe dürfen wir glauben, dass Gott zu uns ja gesagt hat und uns beisteht. Und vielleicht wurden ihnen, liebe Mitfeiernde, in ihrem Leben sogar Erfahrungen geschenkt, die sie als Gottes-Begegnungen und Zusagen erlebt haben. Oft bleiben innere Gewissheiten, die uns Sicherheiten, Überzeugungen schenken. Oder auch ein klares Gespür für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Gerechtigkeitsempfinden kann nach der Bibel Ausdruck von Gottes Gegenwart in unserem Leben sein. Im Titusbrief hörten wir zusätzlich vom besonnen leben, als Zeichen Gottes Wirken in unserem Leben.
Vielleicht mögen die Zusage aus dem Glauben lieber etwas theologischer formuliert. In der Lesung hörten wir: Den Heiligen Geist hat Gott «in reichem Mass über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen.» Tit 3,6-7. Kurz gesagt: es geht um Gottes Ja zu uns und des Geistes Wirken in unserem Leben. Amen.
Wertschätzung und Zeichen
Predigt vom 19. Dezember 2021 zu Lk 1,39-45
Liebe Brüder, liebe Schwestern
Begegnungen prägen unser Leben und können Ausdruck von unserem Glauben und unserer Nächstenliebe sein. Spezielle Begegnungen werden auch als Gott gegeben, oder sogar als Gottesbegegnung wahrgenommen. Franz von Assisi erzählt in seinem Testament:
«Es kam mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selber hat mich unter die Aussätzigen geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam in Süssigkeit der Seele und des Leibes verwandelt». Test 1b-3a
Sowohl bei Franziskus wie auch bei Maria und Elisabeth geschieht Begegnung nicht irgendwie im Kopf und abstrakt. Nein, sie ist körperlich und sozial wahrnehmbar. Sie geht tiefer und wird auch körperlich wahrgenommen. Sei dies das hüpfende Kind im Bauch der Elisabeth oder sogar der Geschmacks-wandel vom bitter zur Süssigkeit der Seele und des Leibes bei Franziskus.
Vor zwei Monaten war ich an einer Ausbildung für Spitalseelsorger. Clinical Pastoral Training heisst sie. Dabei wurden seelsorgerliche Begleitgespräche aus der Praxis sowie freie Gespräche analysiert. Als Wegweiser wurde mir dabei der Merksatz: Weg von der Blackbox, aber Wertschätzung und Zeichen geben. (2x)
Blackbox: Der Mensch ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine Geschichte und Gefühle; Erinnerungen und Stimmungen. Bei einem schlechten Bauchgefühl helfen Argumente meist wenig. Vordergründig scheinen Meinungsverschieden-heiten oft sachliche Fragen zu betreffen. Aber der andere – dann gerne als Sturkopf wahrgenommen – muss mit seinen Gefühlen, Überzeugungen und Ängsten wahrgenommen werden. Er ist ein soziales Wesen aus Fleisch und Blut, kein Computer und kein Roboter. Weg von der Blackbox heisst hier tiefer sehen und den ganzen Menschen wahrnehmen. Mit Herz und Sinnen, Erinnerungen.
Bei der Begegnung von Maria und Elisabeth treffen sich keine Blackboxen, sondern Menschen, die sich kennen und sich gegenseitig etwas Wert sind. Der Text spricht von einer grossen Vertrautheit zwischen den beiden Frauen. Maria eilt und kann nicht warten, bei Elisabeth anzukommen, einzutreten und mit Elisabeth ihr Mutterglück zu teilen. Elisabeth spürt bei der Begegnung das Kind hüpfen in ihrem Bauch und ruft mit lauter Stimme. Wie viel Körperlichkeit hier mit der Begegnung und mit dem heiligen Geist in Verbindung gebracht wird, lässt staunen. Gott bewegt konkret. Mit Fleisch und Blut.
Wertschätzung und Zeichen geben ist der zweite Schritt in der Begegnung. Den anderen also nicht nur wahrnehmen, sondern auch segnen, wie es Beispielsweise Elisabeth mit Maria macht und sie so wertschätzt. Sie schweigt nicht und denkt Gutes, sondern Elisabeth bringt Gefühle auch im Ruf akustisch zum Ausdruck. Im Testament schreibt Franziskus von «Barmherzigkeit erweisen». Das meint hier nicht, den Armen mit Geld oder Gütern abspeisen, sondern die Aussätzigen körperlich wahrnehmen und pflegen, mit ihnen Kontakt pflegen. Sie wertschätzen, sich ihrer anzunehmen.
Vielleicht ist bei diesem Thema auch daran zu erinnern, dass das Schwyzer Kloster heute so zentral, nahe der Kirche liegt, weil die Kapuziner während der Pest in Schwyz sich auch um die Pestkranken verdient gemacht hatten und darum in die Stadt hinein geholt wurden. Sie hatten nicht nur gebetet und gepredigt, sondern sie hatten sich pflegend eingesetzt. Auf der Tafel dort steht unter anderem zu lesen: «Hier ruht in Gott Michael Angelus Meyer … im Rufe der Heiligkeit als Opfer des Pestkrankendienstes vom Klösterli St. Joseph in diese Kirche übertragen …» Und von nicht ungefähr betont der ehemalige Schweizer General der Kapuziner weltweit, Mauro Jöhri, dass die Kapuziner in den Anfängen dank der Pflege bei den Menschen beliebt wurden. Nicht als Kopfmenschen, sondern als Brüder der Nächstenliebe und der Pflege.
Elisabeth und Maria, aber auch Franz von Assisi sowie Michael Angelus Meyer haben es uns vorgelebt: Weg von der Blackbox, aber Wertschätzung und Zeichen geben. (2x) Und auch heute noch wird das unser Christsein prägen und gestalten. Vielleicht ist dieser Merksatz eine weitere Formulierung für den manchmal etwas abgegriffenen Begriff «Nächstenliebe»: Dem konkreten Menschen in meiner Nähe ein Gesicht geben, seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen und ihm Wertschätzung und Zeichen zukommen lassen, das wünsche und rate ich uns immer wieder neu. Amen.
Predigt zu Christkönig
Die «ökumenischen Novembergespräche Schwyz» hatten den Titel «Komische Zeit». Ja, wir leben in spannenden und aufregenden, aber auch belastenden Tagen. Nicht nur für einzelne, sondern auch sozial und politisch ist da einiges durcheinandergeraten. Denken wir neben Burnout und Mobbing an die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Dabei ist es nicht mehr nur das Virus, das uns mit seiner Bedrohung auf Trab hält, sondern auch die daraus entstandenen sozialen Konflikte. Impfgegner und Impfbefürworter können teilweise nicht mehr miteinander reden. Freundschaften und Familien zerbrechen, auch da, wo man das nie erwartet oder geahnt hätte.
Dann tönt mir immer noch Glasgow in den Ohren nach. Jeder und jede versucht sich da möglichst gut darzustellen, denn die Grenzen der Natur sind den meisten von uns einsichtig. Hier sind die Leugner eher etwas verstummt. Aber die Fragen sind sehr komplex und wir selbst möchten ja möglichst so weiterleben wie bisher – oder vielleicht noch etwas besser. Es sollen doch die anderen mit Einschränkungen beginnen. Wir geben uns doch zumindest etwas Mühe und tun dies oder jenes. Wir investieren ja einiges an Geld für grüne Technologien. Aber Mutter Erde wird trotzdem kränker und kränker.
Und dann haben wir jetzt November, erleben die kurzen und dunklen Tage, das Absterben und das Ruhen der Natur. Auch ist es die Zeit, da wir unserer Endlichkeit bewusst werden. Liebe Menschen sterben und sind nicht mehr da. Der Theologe Fulbert Steffensky ermunterte an den «ökumenischen Novembergesprächen Schwyz» zum «Mut zur Endlichkeit». Auch persönlich werden wir uns unserer Grenzen bewusst, bis hin zum Sterben. Und die Statistiken zeigen leider, dass die meisten von uns erst nach einer längeren Leidens- und Sterbezeit davon erlöst werden. Triste Gefühle werden da wach.
Ja, eine komische Zeit, in der wir leben. Wo kommt Hoffnung her? Und da wünsche ich mir, dass die nächtliche Vision im Buch Daniel Wirklichkeit würde: «Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter» (Dan. 7,14). Welch eine Vision. Was für eine Hoffnung! Welche Kraft! Komm lieber Gott, mache Ordnung auf dieser deiner Erde und sei barmherzig; so schreit mein Herz. Zeige dich in dieser komischen Zeit. Doch, ich schaue um mich und sehe viele Fragwürdigkeiten, Krankheiten, Überforderungen, Angst, Grenzen.
Vor 2000 Jahren hat Jesus von Nazareth gelebt und uns nach unserem Glauben das Leben, Erlösung gebracht. Wo ist er und sein Reich Gottes geblieben? Das Kirchenjahr schlägt uns heute am Christkönigssonntag die Begegnung von Jesus mit Pilatus zum Betrachten vor. Wie im römischen Reich üblich, darf der Angeklagte vor dem Richter, dem Regierenden zu seinem Fall Stellung beziehen. Der Vorwurf an Jesus ist der Anspruch «König der Juden» zu sein. (Joh. 18,33-37) Und als solcher würde Jesus die römische Macht in Palästina gefährden und nach römischem Recht zum Tod verurteilt werden. In der Hoffnung des alttestamentlichen Buches Daniel würde die Machtübernahme Jesu eine ewige, unvergängliche Herrschaft Gottes bedeuten. Pilatus müsste sich vor Jesus wirklich fürchten und abdanken. Denn seine Macht wäre dahin.
Jesus von Nazareth gibt Entschärfung. «Mein Königtum ist nicht von dieser Welt», sagt er, und «Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege». Daniels Hoffnung, dass der Menschensohn die Welt auf den Kopf stellt und alles mit Gewalt ordnet, das können wir vergessen. Es wäre schön gewesen, heute eine durchschlagende Lösung zu haben. Diese gibt Gott uns nicht. Doch können wir das Reich Gottes auch nicht nur einfach in eine ferne Zukunft verbannen, wie das der Prophet Daniel konnte. Jesus Christus lebt und hat die Welt erlöst. So die österliche Botschaft vor bald zweitausend Jahren. Jesus sagt dem Pilatus, er lege für die Wahrheit Zeugnis ab. Übrigens eine Wahrheit, die wir hörend auf seine Stimme, auf sein Wort und Tun erleben und erfahren können: «Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme».
Wie ist nun das Königtum Jesu im Heute zu verstehen und vor allem zu leben? Seine Engel oder sogar Armeen ruft Jesus auch heute nicht. «Wahrheit» ist das Stichwort, welches uns der Evangelist Johannes schenkt. Es ist dies eine Wahr-heit, die auf Beziehung mit Jesus, auf Vertrauen in Gott setzt. Eine Wahrheit, die davon ausgeht, dass wir Hörende werden. Hörend auf Jesu Stimme, vielleicht so hörend auf die Natur, hörend auf Menschen; friedfertig und gewaltlos, ehrlich und authentisch, glaubwürdig wie Jesus selber es war. Und wenn ich auf die «ökumenischen Novembergespräche Schwyz» höre, dann muss ich als Mensch nicht perfekt sein, gut sein genügt; ich darf mutig zu meiner Endlichkeit und zu meinen Grenzen stehen, aufmerksam im hier und jetzt leben und handeln. Dies tat auch Jesus von Nazareth in der Begegnung mit Pilatus. Keine grossen Worte und Machtbekundungen. Zuhören, schweigen und das wichtige sagen und tun. Eben, Wahrheit leben in all meiner Menschlichkeit. Amen.
Familiengeschichten
Vom 16. bis 30. November bin ich bei der Zürcher Telebibel mit Josef, Jakob und seinen Söhnen aus dem alttestamentlichen Buch Genesis unterwegs. Eifersucht und Geltungsdrang zerstören die Familienharmonie. Die Bibel erzählt diese Geschichte mit vielen und feinen Nuancen. Hier können die Beiträge gehört werden. Viel Vergnügen.
Editorial ITE 2021/5
Offene, freudige Kinderaugen, das ist ein Bild für Weihnachten. Beim Wandern eine Eselin zu sehen, erinnert mich an Weihnachten. Aber auch eine schöne bereichernde Überraschung im Alltag verbinde ich mit Weihnachten. Und erleben wir dies in unserem Alltag, dann empfinden wir vielleicht einen heiligen Schauer, ein innerliches Jauchzen, dankbar und glücklich.
«… jeder Tag ein wenig Weihnachten», so lautet der Untertitel dieser ITE-Ausgabe. Auch Mutter Teresa hat sich von Weihnachten bewegen lassen, wenn sie sagt: «Jeder Tag ist Weihnachten auf der Erde, jedes Mal, wenn einer dem anderen seine Liebe schenkt, wenn Herzen Glück empfinden, ist Weihnachten, dann steigt Gott wieder vom Himmel herab und bringt das Licht.» Liebe Leserin, lieber Leser, wie würde Ihr «Weihnachtssatz» aussehen? Oder würden Sie lieber zu einem Bild greifen?
Weihnachten spielt mit Stimmungen und greift das Licht in der Dunkelheit auf, den grünen Tannenbaum im kahlen Laubwald, das schutzlose Kind in der kalten Welt. Es sind dies Grundstimmungen, die alle Menschen prägen und Christen mit dem Menschwerden Gottes in Verbindung bringen, dem hilflosen Kind in der ärmlichen Futterkrippe, das der ganzen Welt Hoffnung bringt und in den Erzählungen Heerscharen von Engeln vom Himmel zur Erde kommen lässt. Und dann stehen da die Hirten und über ihnen frohlocken die Engel. Licht, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden sollen werden und uns erfüllen.
«… jeder Tag ein wenig Weihnachten», war die Ursprungsidee unserer Redaktion für diese Weihnachtsnummer. Nicht vergessen haben wir dabei jedoch auch «Gott wurde Mensch», einer von uns und solidarisch mit uns. Dabei wird er von Maria und Josef ernährt. Er ist von zwei Menschen abhängig und auf Fürsorge und Liebe angewiesen. Wenn der eine oder andere Text Sie weihnächtlich verzaubert, Licht, Freude sowie Hoffnung in Ihren Alltag bringt – selbst wenn dieser nicht nur lichtvoll ist –, dann ist Weihnachten geworden. Frohe Weihnachten und Gottes menschliche Nähe, dies wünsche ich Ihnen in den kommenden Wochen.