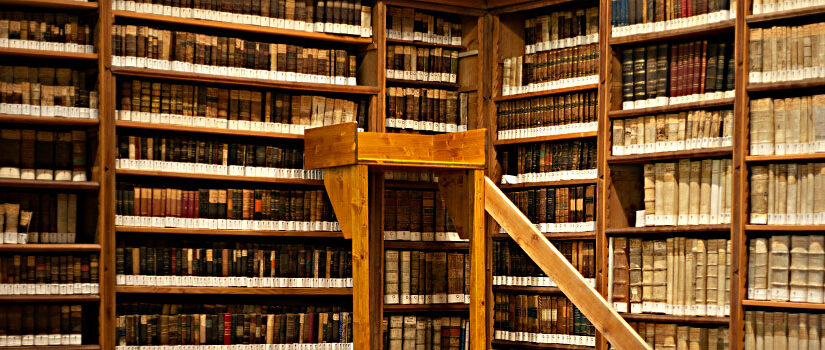Predigt vom 1. September 2024; Mk 7,1-23
Die
Habsburger, die ursprünglich aus der Schweiz kommen, kannten eine getrennte
Bestattung. Nach dem Tod wurde der Körper vom Herz getrennt und an
unterschiedlichen Orten bestattet. Man ging damals davon aus, dass im Herz das
Zentrum des Menschen ist und dass im Herz der Ort der menschlichen Identität,
sein Willenszentrum liegt. Ohne Herz kein Leben. Deshalb hat man früher vom
Herztod gesprochen. Heute ist der Herztod keine verlässliche Todes-Indikation
mehr. Wir wissen es anders. Bei Herzoperationen kann das Herz stillgelegt und
durch Maschinen ersetzt werden. Später lässt man das Herz wieder arbeiten und
das Leben geht weiter. Ein stillstehendes Herz bedeutet nicht mehr den sicheren
Tod. Auch können Herzen transplantiert werden, ohne dass das neue Herz seine
Identität in den fremden Körper mitnehmen würde. Das Herz gilt nicht mehr als
das geheimnisvolle und unbekannte Zentrum des Menschen. Kardiologen und
Kardiologinnen haben das Herz als Organ erforscht.
Heute gehen
viele Menschen davon aus, dass das Hirn der entscheidende Ort des Menschen ist.
Deshalb wurde der Hirntod zu einer Indikation für Leben und Tod. Gibt es im
Hirn keine Energie mehr, dann ist der Mensch tot, so sagt diese Vorstellung. Ob
dem so ist und wann der Mensch wirklich tot ist, das ist eine schwierige,
medizinische und umstrittene Frage. Vor allem bei der Organtransplantation ist
diese Einschätzung wichtig. Wann ist der Mensch tot und wann darf man ihm
Organe entwenden. Eine knifflige Frage.
Es gibt
Menschen, die lassen sich einfrieren und hoffen, eines Tages wieder aufgetaut
und zum Leben erweckt zu werden. Und eben, heute gibt es Menschen, die es
ähnlich machen wie die Habsburger. Sie lassen den Körper beerdigen und
verwesen, aber den Kopf einfrieren und aufbewahren. Das Hirn müsste im neuen
Leben reichen, um wieder ins Leben zu kommen. Da sind die wichtigen Daten eines
menschlichen Lebens gespeichert, wie auf einer Computer-Festplatte. Der Körper
scheint austauschbar, wie in einigen Computerspielen, wo ein Spieler, eine
Spielerin mehrere Leben in unterschiedlichen Körpern leben kann. Aber das
Gehirn bleibt.
Wenn Jesus im
heutigen Tagesevangelium sagt, «von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen
die bösen Gedanken» usw., dann hat er die Vorstellung, dass das Herz den
Menschen ausmacht. «All dieses Böses kommt von innen und macht den Menschen
unrein». Jesus von Nazareth hat vor zwei tausend Jahren gelebt und gewirkt.
Dabei hat er sich mit seinen Worten in den damaligen Vorstellungen bewegt,
welche nicht mehr unsere sind. Damals war das Herz das Zentrum des Menschen.
Während dem
Studium der Erziehungswissenschaften hat einer meiner Psychologie-Professoren
Wert daraufgelegt, dass der Mensch auch in der Psychologie ein Geheimnis ist
und bleibt. Die Psychologie gibt Hilfen für die Analyse des Menschen und kann
manchmal Heilung bewirken. Aber sie belässt auch vieles offen und
unbeantwortet. Was den Menschen im innersten ausmacht, das lässt sie offen, das
ist und bleibt Geheimnis. Ein anderer Psychologie-Professor meinte jeweils,
dass diese Frage von den Theologen und Theologinnen beantwortet werden müsste. Für
uns Christen und Christinnen ist Gott ein Geheimnis – und sein Ebenbild, der
Mensch ist und bleibt auch ein Geheimnis, Gottes Geheimnis.
Aber wie
Jesus, kann die Psychologie einiges zu «bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl,
Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifungen, Neid, Lästerung,
Hochmut und Unvernunft» sagen. Doch lässt sich auch hier kritisieren: Ihr gebt
die Wahrheit (Gottes Gebot) preis und haltet euch an die Theorien
(Überlieferung) früherer Zeiten und vergangener psychologischer Grössen. Auch
heute müssen wir uns wie vor zweitausend Jahren fragen, was trägt noch und was
ist bloss Augenwischerei vergangener Zeiten. Was sind die Themen unserer Zeit?
Nicht
Äusserlichkeiten sagt Jesus. Ich würde in heutiger Sprache sagen, der Mensch
ist keine Maschine, sondern ein Geheimnis, das entscheidungsfähig ist, das oft
zwischen gut und böse unterscheiden muss, auch wenn es manchmal Zeit braucht
und Geduld, die Wahrheit und die echten Lösungen zu ergründen. Und auch heute
sind wir Menschen aufgefordert rein zu sein, vielleicht in unserer Sprache
gesagt, integer, vertrauens- und glaubwürdig, authentisch und wahr; konstruktiv
und mit Verantwortung für unsere Nächsten wie für uns selbst.
Ab dem ersten September, heute also, rufen die Kirchen zur Schöpfungszeit auf, die bis zum vierten Oktober, dem Franziskustag, dauert. Auch heute geht es um die zwischenmenschliche Verantwortung, wie sie Jesus von Nazareth im Tagesevangelium einfordert. Doch für uns Menschen heute kommen neue Themen und Sorgen hinzu. Wir haben plötzlich eine enorme Verantwortung für die Natur, Tiere und Pflanzen, für die ganze Erde in unseren Händen. Wir haben diesbezüglich eine enorme Kraft, auch Zerstörungsmacht entwickelt. Das ergibt eine neue Verantwortungen für unser persönliches, wie für unser christliches als auch gesellschaftliches Leben.
Wir sind gefordert uns für das Leben, für die Schöpfung Gottes stark zu machen. Dabei müssen wir – wie Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten auffordert – stets neu ergründen, was Gottes Wille sei. Oftmals tragen alte Antworten nicht mehr. Zu dieser Suche und immer wieder neu entdecken, wünsche ich uns Fantasie, die richtigen Ideen und gute Absichten; aber auch Freude mit Gott an seinem Schöpfungswerk teilzuhaben.